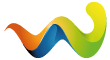Gemischaufbereitung (Vergaser)
Ich möchte zunächst kurz auf die Grundlagen der technischen Verbrennung im (Otto-) Motor eingehen damit der Zusammenhang zur Gemischaufbereitung deutlich wird und das Verständnis verbessert wird. Wen das nicht interessiert oder wer das kennt, kann ruhig später einsetzen.
Um eine Verbrennung im Motor überhaupt zu ermöglichen, muss ein zündfähiges Gemisch erzeugt und in den Brennraum geführt werden wo es durch die Zündkerze schließlich entzündet wird (Fremdzündung). Unter einem zündfähigem Gemisch ist dabei ein Kraftstoff-Luft-Gemisch (in unserem Fall des 2-Takt-Ottomotors ein Benzin-Luft-Gemisch) zu verstehen, bei welchem der unter Normalbedingung flüssige Kraftstoff in die Gasphase überführt und mit der Luft vermischt wurde, so dass sich die Luft und Kraftstoffmoleküle nun fein vermengt nebeneinander befinden. Dabei ist jedoch das Verhältnis von Kraftstoff zu Luft (Kraftstoff-Luft-Verhältnis, siehe nächsten Absatz) sehr entscheidend.
Wen es genauer interessiert kann den folgenden Absatz lesen, wer nur oberflächlich interessiert ist kann ihn auch weg lassen.
Bei der Verbrennung handelt es sich korrekt betrachtet eigentlich um eine Oxidation (Reaktion des Kraftstoffes mit dem in der Luft enthaltenden Sauerstoffs). D.h. betrachtet man das Gemisch auf Molekülebene, gibt es einen Zustand bei welchem eine vollständige Verbrennung stattfindet. Dies ist der Fall, wenn genau so viele Kraftstoffmoleküle vorhanden sind wie für die Reaktion mit den vorhandenen Sauerstoffmolekülen notwendig ist. Man spricht in diesem Fall vom "stöchiometrischen Verhältniss" welches beim Ottomotor 1:14,7 beträgt.
Es ist wohl verständlich, dass es sehr schwierig ist dieses exakte Verhältnis auf Molekülebene im realen Verbrennungsprozess des Motors einzuhalten. Daher erfolgt selten eine vollständige Verbrennung. Es kann entweder zu Kraftstoffüberschuss (Sauerstoffmangel) oder Sauerstoffüberschuss (Kraftstoffmangel) kommen. In beiden Fällen unterscheidet sich das Kraftstoff-Luft-Verhältnis vom genannten "Idealwert". Wird die Abweichung zu groß, kann das Gemisch nicht mehr entzündet werden (beim Ottomotor liegt die Zündgrenze in etwa zwischen 1:10 und 1:18 ). Die relative Abweichung dazu (als Luftmassenverhältnis) von vorhandener zu idealer Luftmenge wird als Lambda bezeichnet. Hierbei bedeutet
- Lambda = 1: vollständige Verbrennung
- Lambda < 1: unvollständige Verbrennung, Kraftstoffüberschuss ("fettes Gemisch")
- Lambda > 1: unvollständige Verbbrenung, Sauerstoffüberschuss ("mageres Gemisch")
Die Aufgabe des Vergasers als gemischaufbereitende Einheit ist es also nun, dem Motor ein möglichst optimales, zündfähiges Gemisch in Abhängigkeit seines jeweiligen Betriebszustandes zu liefern.
Dies ist DIE Aufgabe des Vergasers, welche auch der grundlegende Ansatz eines jeden Tuning-Versuchs ist (dazu später mehr).
Befassen wir und also zunächst mit der Funktionsweise des Vergasers in seiner einfachsten Form am Beispiel des 2-Takt-Ottomotors:
Der Ansaugkanal im Vergaser bildet i.d.R. eine Engstelle in der gesamten Ansaugstrecke, so dass hier eine hohe Strömungsgeschwindigkeit herrscht. Aus der Strömungstechnik ist bekannt, dass bei Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit der Druck fällt, es entsteht ein "Unterdruck". Dieser saugt das Benzin durch den Düsenstock aus der Schwimmerkammer, wobei es durch die Düse zerstäubt wird und sich so ein Benzin-Luft-Gemisch bildet. Die Steuerung, wie viel Gemisch dem Motor zugeführt wird erfolgt in der Regel über eine Drosselklappe bzw. Drosselschieber. Wie der Name schon sagt "drosselt" er die Gemischzufuhr entsprechend der Anforderungen/Vorgaben indem der Strömungsquerschnitt des Vergasers verringert wird.
In unserem Fall haben wir einen Drosselschieber welcher direkt über den Gashebel betätigt wird und senkrecht in den Strömungskanal eintaucht. Da im gedrosselten Betrieb ("Teillast") entsprechend der verringerten Gemischmenge auch eine kleinere Menge Benzin benötigt wird um ein zündfähiges Gemisch zu erzeugen (das Kraftstoff-Luft-Verhältnis muss eingehalten werden), muss dies reguliert werden. Das erfolgt durch eine konische Nadel ("Teillastnadel") welche im Drosselschieber eingesetzt ist und in die Nadeldüse eintaucht, wodurch der Querschnitt und damit die Benzinmenge verringert wird.
Ist der Drosselschieber komplett geöffnet (idealerweise ist der Strömungsquerschnitt komplett freigegeben), hat auch die Teillastnadel keinen Einfluss mehr auf die Gemischzusammensetzung (daher der Name), die Benzinmenge wird nun nur noch durch die Hauptdüse reguliert.
So, nun aber genug der Vorgeschichte, nun können wir uns mit den Möglichkeiten zur Optimierung der Gemischaufbereitung (ich sage bewusst nicht "Tuning") befassen. Ich möchte dabei nur die Möglichkeiten und deren Auswirkungen aufzeigen aber keine Step-by-Step Anleitung zur idealen Abstimmung verfassen, denn die gibt es nicht.
Grundvoraussetzung für jede Abstimmung eines Vergasers sollte natürlich zunächst einmal die Sicherstellung der Funktion sein. Sprich: alle Düsen, Kanäle und Ventile sollten sauber sein, die Dichtungen ihre Aufgabe auch wirklich wahrnehmen und alle mechanischen Elemente so funktionieren wie es vom Konstrukteur gedacht war. Ist dieser Schritt getan, geht es an die Zielsetzung für die Abstimmung:
Man sollte sich fragen, was man mit der Abstimmung erreichen möchte. Das ist zwar in der Regel vorher klar, ich möchte es der Vollständigkeit halber hier jedoch trotzdem erwähnt haben. Für die meisten Leser hier wird die Zielsetzung sein: maximale Leistung.
Es soll jedoch auch Leute geben, die auf einen geringen Spritverbrauch und gutes Ansprechverhalten mehr Wert legen, ich werde daher auf beides eingehen.
Wie bereits Eingangs erwähnt ist das Ziel immer die Optimierung der Gemischzusammensetzung. Doch was ist jetzt optimal für welchen Zweck? Und: Wie beurteile ich das?
Zunächst zur Beurteilung:
Da man nur schlecht bei der Verbrennung zuschauen kann (und selbst wenn man es könnte wäre es viel zu schnell vorbei) muss eine andere Möglichkeit gefunden werden die Gemischzusammensetzung zu beurteilen. Hierfür wurden Lambdasonden entwickelt die den Restsauerstoffgehalt des Abgases messen können und damit einen Lambda-Wert liefern welcher zur Beurteilung heran gezogen werden kann. Da das für die Meisten hier wohl zu aufwendig (und teuer) sein wird, kann vereinfacht auch das Kerzenbild dazu heran gezogen werden. Dies hat natürlich etliche Nachteile (wäre sonst ja auch zu schön um wahr zu sein): Das Kerzenbild stellt sich erst nach einiger Zeit ein, eine wirkliche Beurteilung der Gemischzusammensetzung in Abhängigkeit des aktuellen Betriebszustandes ist daher unmöglich. Weiterhin lässt sich das Kerzenbild schlecht eindeutig beurteilen. Was für den Einen noch "hellbraun" ist, ist für den Nächsten schon fast "weiß". Hier helfen jedoch ggf. Tabellen aus. Auch die Umgebung (z.B. das Wetter) übt manchmal einen erstaunlich großen Einfluss auf das Kerzenbild aus, was eine Beurteilung zusätzlich erschwert. Jedoch, uns bleibt ohne einen erheblichen Mehraufwand keine andere Möglichkeit, weshalb wir nur das Kerzenbild nutzen können. Allgemein gilt bei der Beurteilung: Je dunkler das Kerzenbild, desto mehr Kraftstoff stand bei der Verbrennung zur Verfügung, bei hellem Kerzenbild ist von Sauerstoffüberschuss auszugehen. Es wird meist zu einem "rehbraunen" Kerzenbild geraten, was dann einer optimalen (annäherend vollständigen) Verbrennung entsprechen soll. Dies hängt jedoch auch wieder von mehreren Faktoren ab, kann jedoch so in etwa im Hinterkopf behalten werden.
Ich denke es ist überflüssig zu erwähnen (ich tue es trotzdem) dass die Gemischzusammensetzung nur bei betriebswarmen Motor geprüft werden darf, da sich sonst eine Verfälschung der Ergebnisse ergibt. Bei Beurteilung über das Kerzenbild erübrigt sich dies, da bei der Strecke welche gefahren werden muss bis sich ein vernünftiges Kerzenbild einstellt der Motor ohnehin seine Temperatur erreicht.
Nun zu: "Was ist optimal?":
Auch dies hängt wieder von der Zielsetzung ab, wobei allgemein gilt: Es gibt nicht "DEN" Optimalwert, dafür gibt es zu viele Einflussfaktoren. Man kann sich hier nur möglichst nahe an die geforderten/gewünschten Werte heran tasten, was schon kompliziert genug ist.
Zu den beiden genannten Zielsetzungen der Abstimmung ist zu sagen:
- maximale Leistung: wird bei leicht fettem Gemisch (Lambda = ca. 0,85 bis 0,95) erreicht
- geringer Benzinverbrauch (geringer Schadstoffausstoß) zusammen mit gutem Ansprechverhalten als Kompromiss zur Leistung: leicht mageres Gemisch (Lambda = ca. 1,05 - 1,15)
Daraus folgt also: für das Erreichen der maximalen Leistung ist auf ein etwas dunkleres Kerzenbild hin zu arbeiten, für einen geringen Verbrauch auf ein helleres.
Nun zu den Optimierungsmöglichkeiten:
- Volllastbetrieb:
Hier ist nun der Schieber vollständig geöffnet (zumindest idealerweise) und die Nadel sollte nicht mehr in die Nadeldüse hinein ragen. Die Dosierung der Benzinmenge für die Gemischaufbereitung ist nun im Wesentlichen von der Hauptdüse abhängig. Dabei gilt jedoch nicht "viel hilft viel", also die größte Hauptdüse ist nicht unbedingt die Beste. Es kommt wie Eingangs beschrieben auf das richtige Verhältnis an. Der Luftmassenstrom (welcher dieses beschreibt) hängt von dem Strömungsquerschnitt des Vergasers und der dort herrschenden Strömungsgeschwindigkeit ab, welche wiederum durch die Baugröße des Vergasers und den Betriebszustand des Motors (in erster Linie der Drehzahl) abhängt.
Klingt erstmal alles ziemlich komplex, ist es aber auch. Die Baugröße des Vergasers und damit der Strömungsquerschnitt ergibt sich durch den Motor und die gewünschten Zieldaten für diesen. Für einen hubraumstarken Motor wird dieser meist größer ausfallen als für einen kleinen Motor, für einen Motor mit hoher maximaler Drehzahl verhält es sich gegenüber einem mit relativ geringer maximaler Drehzahl ähnlich. Die optimale Baugröße ergibt sich auch hier wieder nur durch Erfahrung oder aufwendiges Erproben. Alternativ und so man es denn möchte kann man hier jedoch auch eine etwaige Größe berechnen.
Über die Baugröße (den Strömungsquerschnitt) lässt sich allgemein sagen: je kleiner dieser ist, desto besser ist das Ansprechverhalten auch bei geringeren Drehzahlen (geringer Luftmassenstrom im Vergaser). Je größer er wird, desto größer ist der mögliche Luftmassenstrom und damit die erzeugte Gemischmenge. Das Ansprechverhalten in geringen Drehzahlen leidet in diesem Fall jedoch, da die verhältnismäßig große Gassäule im Ansaugtrakt erst in Bewegung versetzt werden muss, wodurch die Gemischbild erst verzögert einsetzt. Im ungünstigen Fall kann dann nur eine geringe Füllung erreicht werden, da der Einlass bereits vor dem Einströmen des Gemisches wieder verschlossen ist. Es muss also ein Kompromiss zwischen beiden Extremas gefunden werden.
Wurde die Baugröße festgelegt, kann durch die Wahl der Hauptdüse somit die Gemischzusammensetzung unter Volllast beeinflusst und auf den gewünschten Wert (Zielsetzung, Kerzenbild) eingestellt werden.
Der Luftmassenstrom welcher mit Benzin angereichert werden muss, ist nun durch den Strömungsquerschnitt und die Drehzahl des Motors sowie dessen grundlegende Daten bestimmt, weshalb sich durch die Benzinmenge auch das Gemisch einstellt.
- Teillastbetrieb:
Wie bei der Erläuterung der Funktionsweise des Vergasers bereits erwähnt, hat im (gedrosselten) Teillastbetrieb vor allem die konische Nadel einen Einfluss auf die dem Gemisch zugeführte Benzinmenge. Ihre Form und die Position sind hierbei von entscheidener Bedeutung. Die Form kann nur durch Austausch der Nadel geändert werden. Dabei gilt: je geringer die Steigung des Konus, desto feiner lässt sich die Benzinmenge dosieren. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass auch wirklich der Querschnitt der Nadeldüse freigegeben wird, sonst käme es auch im Volllastbetrieb zu einer Drosselung.
Die Position der Nadel (beim BVF Vergaser und auch vielen anderen Vergasern wird sie über einen Clip eingestellt) bestimmt ebenfalls die Benzinmenge welche für die Gemischbildung zur Verfügung steht. Dabei gilt: je "höher" die Nadel gehängt wird, d.h. bei gleicher Schieberposition taucht ein dünnerer Querschnitt der Nadel in die Nadeldüse ein und gibt daher einen größeren Querschnitt dieser frei, desto mehr Benzin wird zugeführt.
Zu guter Letzt hat natürlich auch die Hauptdüse noch einen Einfluss auf die Teillast, dieser ist im Verhältnis zur Volllast jedoch gering. In jedem Fall sollte die Gemischaufbereitung im Teillastbereich nach dem ändern der Hauptdüse überprüft und ggf. korrigiert werden.
---
So, ich hoffe das gibt einen ersten Einblick in die Gemischaufbereitung durch den Vergaser und die Möglichkeiten zur Manipulation. Man könnte jetzt noch auf den Einfluss der Ansauglänge, ggf. Ansaugtrichter, Membraneinlass etc. pp. eingehen, fürs Erste solls jedoch reichen.